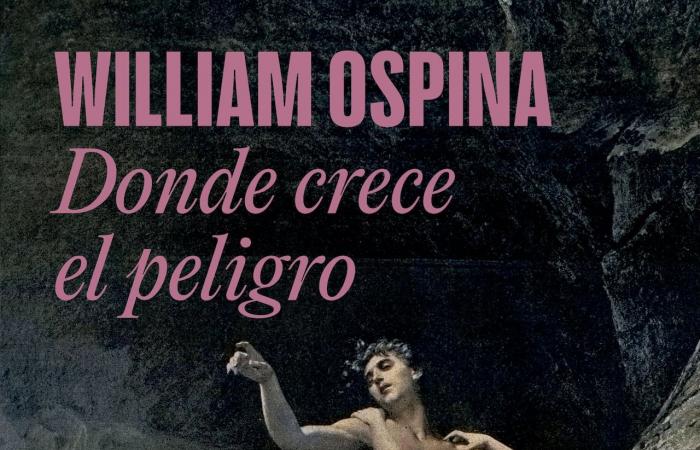Von Laura Valeria López Guzmán / Special für El País
Der Autor aus Tolima sprach mit El País über sein neues literarisches Projekt, seine Beziehung zur Philosophie, Baudelaire, Estanislao Zuleta, Kunst und andere Themen, die in seinen mehr als drei Jahrzehnten als Schriftsteller hervorstechen.
Welche Bedeutung hat Romantik in Ihrem Leben?
Sie kennen Romantik, bevor Sie wissen, was sie ist. Schon in jungen Jahren begann er, sich mit der Natur, Literatur, Malerei und romantischer Musik auseinanderzusetzen. Es gibt eine Art Konzept, das dort im Umlauf ist. Wenn Menschen Wissen erwerben, beginnen sie zu erkennen, dass es bei der Romantik nicht nur um Sensibilität, Sentimentalität oder reine Liebe geht, sondern dass es sich dabei um eine lebenswichtige und historisch sehr wichtige Bewegung handelt, die insbesondere im 19. Jahrhundert eine neue Leidenschaft weckte für Natur und Geschichte. Aber was mich am meisten ermutigte, war, dass das Leben zu einer neuen Leidenschaft wurde, zu einem neuen Abenteuer, um der Trägheit des eintönigen, sich wiederholenden Lebens zu entfliehen, das nach der Ankunft der Französischen Revolution in die Welt gekommen war.
Als ich vor etwa 30 Jahren begann, über die Probleme der modernen Welt nachzudenken, veröffentlichte ich „Es ist spät für den Menschen“, in dem ich zum Ausdruck brachte, dass ich immer das Gefühl hatte, dass die Romantiker vor allem andere Bewegungen die Intuition gehabt hatten, dass Einige Übel würden in der Welt zunehmen und nur durch intensivere Leidenschaften und direkten Kontakt mit dem Leben und der Natur würden diese Übel abnehmen.
In „Where Danger Grows“ gibt es eine Reise durch die Geschichte, vor allem aber eine durch das Leben verschiedener Charaktere, wie unter anderem Nietzsche, Estanislao Zuleta, Freud, aber sobald Goethe erwähnt wird, reden wir über ihn und sein Leben Präsenz in seinen Werken.
Er ist jemand, zu dem ich schon immer eine zwiespältige Beziehung hatte, manchmal eine große Bewunderung, in der ich ihn sehr liebe, manchmal aber auch eine große Spannung und ich ihm bestimmte Dinge vorwerfen möchte. Nun spreche ich in dem Buch, das ich letztes Jahr veröffentlicht habe, „Ich werde mein Ohr an den Stein legen, bis er spricht“, das von Humboldts Reise durch Amerika erzählt, über die Beziehung, die er zu Goethe hatte.
Humboldt besuchte ihn, als er noch sehr jung war, und Goethe war bereits der große Herr der deutschen Literatur. Dieses Treffen war für beide von grundlegender Bedeutung; Humboldt seinerseits wollte als Wissenschaftler Künstler sein; und für Goethe, der als Künstler Wissenschaftler werden wollte. Bei diesem Treffen gaben sie sich also gegenseitig Feedback und Goethe war sprachlos, als er alles hörte, was Humboldt sagte, und er hatte das Gefühl, ihm zuzuhören sei dasselbe wie das Lesen einer Enzyklopädie. Nichts wie Humboldts Besuch hat mir wirklich dabei geholfen, die Figur des Faust, des Mannes, der alles wissen will, zu Ende zu bringen.
Der Charakter des Wissenschaftlers trug also dazu bei, Goethes Charakter zu verfeinern. Und ich interessiere mich auch für den deutschen Schriftsteller, obwohl er kein Romantiker ist, war er ein großer Inspirator der Romantiker. Und er lebte immer an dieser Grenze, zwischen einem Klassiker, einem Gelehrten, einem Akademiker und zwischen einem Liebhaber, der sich den ganzen Tag über für Poesie, Reisen und Kunst interessiert, und diese Neigung macht ihn zu einem sehr attraktiven Charakter.
Warum glauben Sie, dass zeitgenössische Autoren wie Sie in ihren Werken nach Liebe rufen?
Offensichtlich gehorcht dies nicht einem Programm, sondern meiner Meinung nach gehorcht es einem Bedürfnis, einem Moment und einer Erwartung. Meiner Meinung nach haben sich die traditionellen politischen Lösungen, die der Menschheit als große Alternative für den historischen Wandel angeboten wurden, insbesondere diejenigen, die im 20. Jahrhundert aufkamen, als, wenn nicht falsch, so doch zumindest als unzureichend erwiesen.
Wir glauben nicht länger, dass bloße politische Revolutionen die Menschheit grundlegend verändern und es ihr ermöglichen werden, sich den Herausforderungen zu stellen, denen wir heute gegenüberstehen, wie etwa den Herausforderungen, die mit der Natur und unserer Lebensweise zu tun haben. Und das Hauptproblem, mit dem wir konfrontiert sind, ist die Konsumgesellschaft, in der wir leben, da wir diejenigen sind, die das gesamte von der Industrie produzierte Plastik verbrauchen, das heißt, alle Menschen tragen die Verantwortung für die Art und Weise, die Gier und die Geschwindigkeit in dem wir uns auf die Dinge beziehen, die uns der Kapitalismus gibt.
Das ist es, was wir den Feind der Welt nennen können; Das erfordert große Revolutionen, aber solche, die mit dem Verständnis beginnen, dass die Transformation von einem selbst geschieht, dass wir unser eigener Feind sind. Und die Konsumgesellschaft ist sehr schlecht, weil sie die menschliche Kreativität zunichte macht und uns nur dazu einlädt, Zuschauer und nicht Schöpfer zu sein. All dies ist ein Aufruf, das Heil im Dialog mit den bereits bestehenden und auch den kommenden Gefahren zu suchen.
Warum glauben Sie, dass der Mensch versucht, das Heilige zu entweihen?
Wir müssen mit der Tatsache beginnen, dass wir nicht wissen, was heilig ist. Tief im Inneren ist alles heilig, und im gleichen Maße wollen wir das, was heilig ist, nicht entweihen, sondern ignorieren, dass es heilig ist. Jemand sagte, dass wir nicht aus dem Paradies vertrieben wurden, sondern dass dieser „Austritt“ darin besteht, dass wir das Bewusstsein verlieren, dass wir im Paradies sind, und so leben, als wären wir nicht darin. Darüber hinaus spüren wir nicht mehr das Wunder der Dinge oder der Natur, was wunderbar ist. In dieser Gestaltung der Natur, in dieser geheimen Ordnung, die etwas bedeutet und offenbart, liegt eine unendliche Heiligkeit, es ist nur so, dass unsere Art, die Welt zu verstehen, aufgrund von Unwissenheit und Unbewusstheit fast alles entweiht.
In Bezug auf Dialogräume: In welchem Moment ist Ihrer Meinung nach der Mensch eingeschlafen?
Die Menschheit wächst mit beeindruckender Geschwindigkeit. Und je mehr wir sind, desto alleiner sind wir, und das führt dazu, dass unsere Beziehungen und Interessen durch die Industrie, durch die Machtzentren vermittelt werden und sie zunehmend zerfallen. Früher gab es in Kolumbien mehr Cafés, jetzt erholt sich das wieder.
Im Europa des 18. und 19. Jahrhunderts, von Lissabon bis Sankt Petersburg, saßen alle Menschen in Cafés, debattierten, hatten Spaß und bauten eine Art Dialog auf.
Im Falle Kolumbiens war das nun anders. Obwohl uns das ein wenig Spaß machte, hatten die Cafés nicht die gleiche Wirkung wie auf dem alten Kontinent und dies führte dazu, dass wir uns nicht in einem ständigen Gesprächs- und Beobachtungszustand befanden, wo Kunst, Musik und Kultur die Wege für diese Entwicklung waren. Zu all der Gewalt, die wir erlebt haben, kommt noch hinzu, dass wir vor allem in anderen Ländern den Zerfall erleben müssen, der auftritt, wenn die Kunst nicht zusammenkommen darf. Aber wir können dies mit einem Satz von Nietzsche zusammenfassen, der besagt: „Die Wüste wächst, unglücklich ist, wer Wüsten beherbergt.“