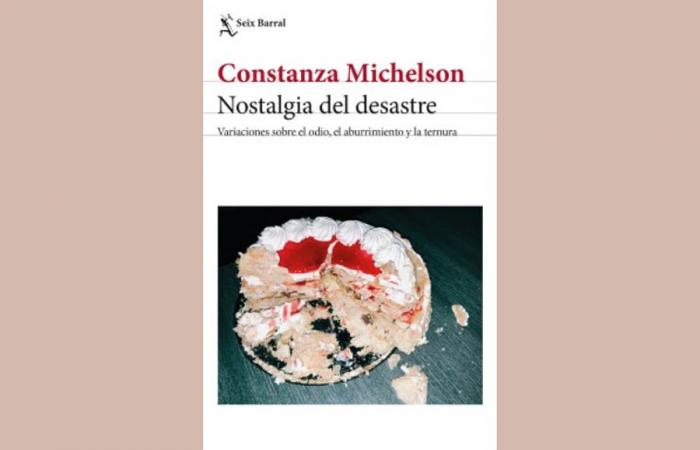Kommentar zum Aufsatz Nostalgie für die Katastrophe. Variationen über Hass, Langeweile und Zärtlichkeitvon Constanza Michelson (Seix Barral, 2024).*
I. RITEN OHNE MYTHEN
UNDIn der letzten Zeile der ersten Seite von Constanza Michelsons Buch heißt es: „Die Dinge gehen weiter; ja, ich vergesse seine Bedeutung. Es ist eine Aussage über den aktuellen Zustand der Welt, die den Ton des Buches völlig bestimmt, und gleichzeitig eine nostalgische Beobachtung, da sie nur von jemandem gemacht werden kann, der die jetzt verlorene Bedeutung kannte. Wenn Nostalgie unter anderem ein Problem impliziert, ein gegenwärtiges Unbehagen über das, was fehlt, ist dies nur für diejenigen von uns der Fall, denen es gelingt, eine Beziehung zu dieser Vergangenheit aufzubauen, und daher ist sie etwas, das mit Sicherheit mit uns verschwinden wird. Wer vorher nicht wusste, was passiert ist, noch keinen Kontakt damit hatte, kann nichts verpassen; aber es erkennt auch nicht die Ersatznatur des Vorhandenen.
Was sind das für Dinge, die weiter marschieren, aber ihre Bedeutung vergessen haben? Nun ja, im Moment fast alles: Politik, Sex, Bildung, Geschichte. Es sind Riten, die ihres Mythos beraubt wurden. Aber an dieser Stelle, bevor wir uns einer „retrotopischen“ Nostalgieströmung zuwenden (Bauman), sollte eine Frage eingefügt werden: Die Wahrnehmung jener Dinge, die weiter marschieren, aber ohne ihre Bedeutung, wird nicht der erste Eindruck dessen sein, was gemacht wird auf uns? Neu, oder besser gesagt, das Unveröffentlichte?
Und paradoxerweise hatten wir „Trotz allem, Modernen“ Probleme, die Neuheit zu begreifen; Denn obwohl modern zu sein bedeutete, für das Neue empfänglich – und sogar produktiv – zu sein, verorteten wir es doch vorzugsweise in einer Dimension, die wir Zukunft nennen, und taten dann alles, um es vorhersehbar zu machen. Darum ging es zum Beispiel im goldenen Zeitalter der Geschichtsphilosophien: um die Zukunft als Verwirklichung des moralischen Fortschritts der Menschheit, eines kosmopolitischen Rechts, vollkommenerer Staats- und Freiheitsformen oder der Größenordnung des Reichtums, die dies ermöglichen würde füllen, schließlich an alle (um auf drei moderne Paradigmen hinzuweisen: Kant, Hegel und Hume). Aber es scheint, dass heute alles anders ist, und wir sind nicht mehr mit dieser Art von Neuheit konfrontiert, sondern mit etwas, das man besser als „das Unveröffentlichte“ bezeichnen sollte, das weitgehend von der Zukunft getrennt ist: Was wir heute erleben, ist eher ein Kontakt mit einer anderen Welt als mit zukünftigen Neuheiten.
Darauf beziehen sich Constanza Michelsons Überlegungen spätestens seit ihren beiden vorherigen Büchern (Bis es lebenswert ist Und mach die Nacht). Er hat beschlossen, unsere Zeit zu erkunden, ohne den Klischees von edlen Anliegen nachzugeben, nicht weil es keine gerechten Anliegen gibt, sondern weil das beste Engagement für sie das von jemandem ist, der uns davon abhält, allzu sicher zu sein, was wir denken und was wir sollten tun. Dies ist per Definition eine antipolitische Haltung; das heißt, verschlossen für Eventualitäten, Kreuzungen und Gelegenheiten.
II. NOSTALGIEN
Obwohl wir immer unter dem leiden können, was verloren geht, ist die besondere Form, die dies in der Nostalgie annimmt, eine wahrhaft moderne Erfahrung; Tatsächlich wurde der Begriff erst 1688 vom Schweizer Arzt Johannes Hofer geprägt, und obwohl er zunächst die Krankheit von Soldaten bezeichnete, die ihre Heimat vermissten, entwickelte sich der Begriff später – bis er im 19. Jahrhundert moralische und literarische Höhen erreichte – passt Punkt für Punkt zur modernen Erfahrung schlechthin: der Revolution als Bruch zwischen Vergangenheit und Gegenwart und der Entwicklung der Fortschrittsdoktrin.
In diesem Buch weist uns der Autor, ganz in der Nähe von Steiner und Dostojewski, auf eine weitere Artikulation von Nostalgie hin, die mit dem Ende der Moderne selbst einhergeht: die „Nostalgie der Katastrophe“. die Faszination einer Generation für die Schrecken, die ihre Vorgänger erlebt haben. Das ist typisch für eine Zeit der Leere und Langeweile, in der alles auch – oder verdächtig – gut funktionieren soll. Das Paradigma hierfür wäre, dass der Staat im Mythos der europäischen Zivilisation und des europäischen Fortschritts des 19. Jahrhunderts verankert war, der das Brachland war, auf dem die wilden Monster, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auftauchten, ausgebrütet wurden. Zwischen der Nostalgie der Katastrophe und dem Todestrieb besteht ein enger Zusammenhang, bei dem es beängstigend ist, weiter zu hinterfragen.
Das war die Milz, typisch für das 19. Jahrhundert, das, wie so vieles vom Ende dieser Ära, das vom Beginn des 21. Jahrhunderts vorwegnahm. Es geht um etwas Ähnliches, aber Anderes: Wenn die Langeweile des 19. Jahrhunderts das Bürgertum stärker erreichte; Die heutige Langeweile wird durch die Standardisierung von Klassen und etwaigen Unterschieden noch verstärkt. Und wenn das frühere aus einer Langeweile gegenüber der Zivilisation und so viel Rationalität entstand, so entsteht das heutige aus dem postemanzipatorischen Zustand all dessen.
Im Gegensatz zu dieser alten Langeweile hat die heutige Langeweile nicht mehr das Vertrauen in die Menschheit, etwas in Gang zu bringen (um „sich selbst zu autorisieren, die Geschichte zu leiten“, schreibt Michelson), weil die Menschheit heute mit sich selbst gelangweilt ist. Es ist nicht verwunderlich, dass heute nicht mehr die Zeit für politische Projekte ist, sondern für „Ausbrüche“, die vielleicht die beste politische Figur der Welt sind. Präsentismus was die Massen betrifft; das heißt, Verzicht oder Unfähigkeit, die Zukunft zu gestalten. „Macht ohne Macht“ jemand sagte. Auf der Ebene des einzelnen Subjekts ist es die Figur des „politischen Akteurs“, die dem Staatsmann, dem Charakter, von dem sie erwartet wurde, den Platz stiehlt Geschichtsbewusstsein: das Gleichgewicht zwischen dem, was man hat und was nicht, „um Träume in Pläne zu verwandeln“ (Berman). Der Händler hingegen improvisiert und reagiert, balanciert chinesische Gerichte und spekuliert, ganz im Börsensinn.
III. ÜBEN SIE DAS LEBEN
Den strukturierenden Schreibstil dieses Buches als biografische Geschichte zu bezeichnen, kann zu einem Missverständnis führen. Nun, es ist eine Geschichte, die weder wörtlich noch linear oder offensichtlich ist: Das „plausible Leben“ wird hier nicht zu finden sein, da es sich vor allem um die ehrliche Geschichte von jemandem handelt, der annimmt, welche Zeit und ihre Angriffe auf das Thema gestern gerichtet sind getan haben. „Das Mädchen, das war“, auf das in der dritten Person Bezug genommen wird, ist keine bloße Stilwahl, sondern das Bekenntnis eines Selbst als eines anderen. Und in Wirklichkeit wird niemandem eine andere Alternative geboten. Was passiert, ist, dass wir besser funktionieren, wenn wir glauben, dass wir vom Anfang bis zum Ende gleich sind – als ob wir die Möglichkeit hätten, konsequent zu sein – und zwar bis zu dem Punkt, an dem wir die Konsequenz hervorheben als höchsten Wert. Es ist das Überbleibsel eines alten, sphärischen Wahrheitsbegriffs.
Daher die untergründige Frage, die sich durch dieses Buch zieht: Was passiert, wenn etwas scheitern sollte, es aber am Ende doch nicht klappt? Weder Vorsehung noch Zufall wirken, sondern Freiheit: „Der Akt wird am Scheideweg gemeistert“, behauptet Michelson. Bedeutung entsteht, wenn wir etwas mit unseren Determinanten machen und sie in Motive umwandeln.
Freiheit, ist das ein zu großes Wort für unsere Zeit? Freiheit ist nicht länger das, was wir haben, um der Zukunft der Menschheit eine Richtung zu geben, das war das moderne humanistische Delirium. Aber Humanismus muss keine Täuschung sein. Zur Mäßigung gezwungen, könnten wir nun von einem „schwachen“ Humanismus sprechen, ohne eine einzige, letzte, normative Grundlage und ausgeschlossen von der Vernunftdomäne (Vattimo): Menschliche Freiheit ist nichts anderes als das, was wir mit unserem Leben und darüber hinaus tun können , mit dem derer, die zu ihnen gehören, mit einem Ergebnis, das nie sicher ist. Sicher ist nur, dass wir die Verantwortung für die Ergebnisse übernehmen müssen. Verantwortung erweist sich als Nachweis der Freiheit.
Und so wie Freud betonte wenn es um den Mechanismus der Humanisierung unkontrollierbarer Naturkräfte geht: „Wir werden uns inmitten des Störenden ruhiger fühlen und werden in der Lage sein, unsere Angst psychisch zu verarbeiten.“ Wir machen vielleicht hilflos weiter, aber wir fühlen uns nicht länger gelähmt.
Dieser Text ist ein Auszug aus der Präsentation des Buches, die der Autor am 7. Juni in Valparaíso hielt.